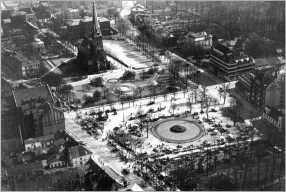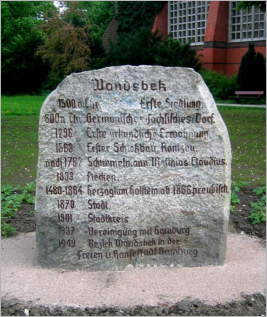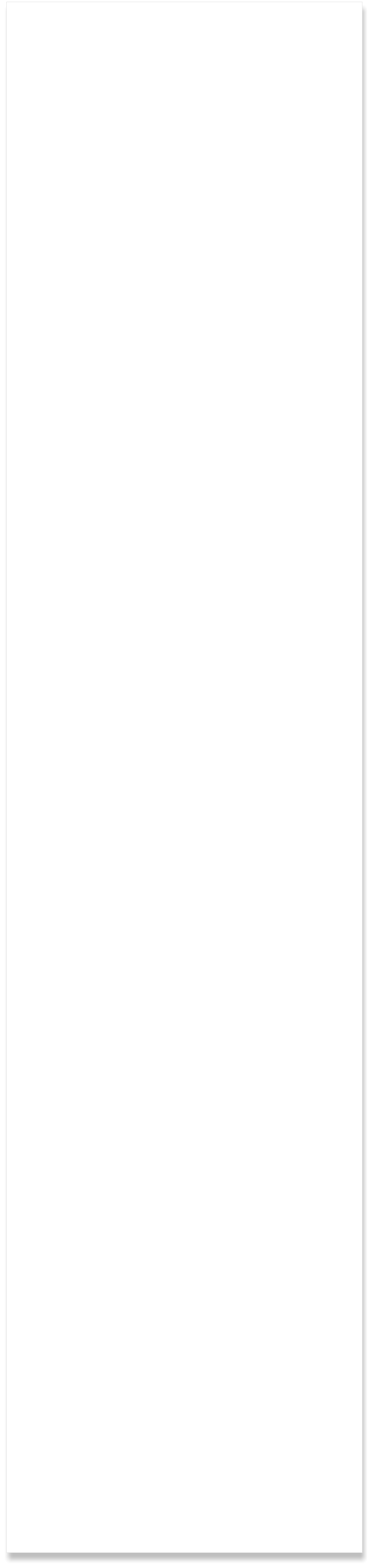


© Bürgerverein Wandsbek von 1848 e. V.
Die Geschichte Wandsbeks
Wandsbek verlor 1937 - wie auch die
Städte Altona und Harburg - seine
kommunale Selbstständigkeit.
Damals hatte die Stadt 48.000 Einwohner.
Die Nationalsozialisten schafften mit einer
gesetzgeberischen Maßnahme diesen
Kraftakt, der durch Verhandlungen in den
Jahren davor nicht ermöglicht werden
konnte und schufen mit dem Groß-
Hamburg-Gesetz die heutige Struktur der
Hansestadt Hamburg. Das ungestüme
Wachstum der Kommunen und der
technische Fortschritt waren die
eigentlichen Gründe, die die Beseitigung
der Grenzen erzwangen und damit eine
sinnvolle Weiterentwicklung dieses
städtischen Siedlungsraumes in
Norddeutschland umsetzten.
Wandsbek, erstmals 1296 urkundlich erwähnt, hatte sich im Laufe der Jahrhunderte von
einer dörflichen Ansiedlung zu einem Lehngut und einem adligen Gut mit herrschaftlichem
Sitz, über einen Fabrikort zu einer kreisfreien Stadt mit 28.000 Einwohnern (1901) entwickelt.
Schleswig-Holstein zugehörig stand es lange unter dänischer und ab 1866 unter preußischer
Verwaltung.
Der Bezirk Wandsbek
Der Bezirk Wandsbek, im Nordosten
Hamburgs gelegen, ist mit über 400.000
Einwohnern heute der Einwohner stärkste
der sieben Bezirke der Metropole. Als
selbstständige Kommune wäre Wandsbek
jetzt die 16. größte Stadt Deutschlands.
Der Name der ehemaligen Stadt wird
mehrfach verwendet, nämlich als Name
für den Bezirk, für das Kerngebiet mit fünf
Stadtteilen sowie für den das Zentrum
bildenden Stadtteil. Selbst nach über
sechzig Jahren ist die Integration in den
Stadtstaat Hamburg durch die Ur-Hamburger mental noch nicht abgeschlossen. Allerdings
wurde in dieser Richtung 1998 vom Senat der Hansestadt ein bedeutender Schritt getan, als
das "Staatsarchiv Hamburg" als erste Behörde aus der Hamburger Innenstadt an den
Wandsbeker Markt verlagert wurde. Postalisch ist der Name Wandsbek endgültig gelöscht:
Aus Wandsbek wurde erst Hamburg-Wandsbek, später Hamburg 70, inzwischen haben nicht
merkbare Postleitzahlen die Zuordnungsgrenzen verwischt. Das zuständige Briefzentrum 20
hat seinen Standort in Mecklenburg.
Das Gebiet der ehemaligen Stadt Wandsbek, umfasst heute die Stadtteile Wandsbek mit
Hinschenfelde, Marienthal, Jenfeld und Tonndorf. Bis zur Eingemeindung nach Hamburg
herrschte wegen der unmittelbaren Nähe zur Hansestadt einerseits stets ein reger Austausch
zwischen beiden Städten, andererseits auf manchen Gebieten Rivalität. Bedeutend war von
altersher die durch Wandsbek führende Straßenverbindung zwischen den Hansestädten
Hamburg und Lübeck. Diese Magistrale mit ihrem regen Handelsverkehr war die Ursache,
dass Wandsbek über Jahrzehnte von einer Zollgrenze durchschnitten war, weil Dänemark
sich gegen den Handelsverkehr der Hamburger abgrenzen bzw. davon profitieren wollte.
Damit genoss ein großer Teil Wandsbeks die Vorzüge des Zollfreiraums Hamburg. Diese
stark befahrene Trasse gibt es noch heute als Bundesstraße 75.
Ein Anziehungspunkt für Erholung suchende Großstädter
Wandsbek war in der zurückliegenden Zeit durch seine Grünanlagen und
Unterhaltungsangebote ein Anziehungspunkt für Erholung suchende Großstädter. Der
Dichter Matthias Claudius (1740-1815), der hier lebte und wirkte, warb aus Überzeugung
für seinen Heimatort und machte ihn durch die von ihm redigierte Zeitung "Der Wandsbeker
Bothe" in der deutschen Geisteswelt bekannt. Der ab 1861 für anspruchsvolle Einzelhaus-
bebauung parzellierte Wandsbeker Schlosspark entwickelte sich zum Stadtteil Marienthal
und zog viele vermögende, Ruhe suchende Hamburger nach Wandsbek.
Lange Zeit war Wandsbek von damals unbekannter Toleranz geprägt. Schon um das Jahr
1600 wurden Juden als Mitbürger geduldet. Sie trugen zur Entwicklung des Gemeinlebens
bei. Ähnliches galt für die Mennoniten. Protestanten konnten ab dem 16. Jahrhundert
Gottesdienste in einem Raum des Wandsbeker Schlosses abhalten. Eine Kirche errichteten
sie 1634. Auch die Gerichtsbarkeit agierte großzügig. In Wandsbek war mancherlei erlaubt,
was anderswo vor keinem Gesetz Gültigkeit hatte. Beispielsweise fanden Bankrotteure und
Schuldner hier eine Freistätte, die vor Verfolgung schützte, oder junge Paare wurden ohne
Zustimmung der Eltern getraut. "Wat narms gelt, dat gelt to Wandsbek" hieß ein kritischer
Spruch in umliegenden Ländern. Die Redensart: "Ach, geh doch nach Wandsbek!", ist noch
heute in Dänemark geläufig.
Florierende Wirtschaft
Auf der anderen Seite betrieben die Wandsbeker Gutsverwalter, insbesondere Heinrich Carl
Graf von Schimmelmann, eine kluge Wirtschaftspolitik. Das Wasser der Wandse wurde
durch zahlreiche Mühlen zur Energiegewinnung genutzt, ebenso diente es Wäschereien und
Bleicherein, um Kattune (Baumwollstoffe) zu säubern und auf den flussnahen Wiesen zu
bleichen. Durch geschickte Maßnahmen wurden Gewerbe- und Industriebetriebe
angesiedelt, die die Bevölkerung in Lohn und Brot setzten. In manchen Branchen erlangten
Wandsbeker Unternehmen landesweit und auch weltweit Geltung, wie zum Beispiel die
Kattundruckerei Lengercke, die Lederfabrik Luetkens, die Gärtnerei Neubert, das Reichardt-
Schokoladenwerk oder die Deutschen Hefewerke, um nur einige zu nennen. Der Handel
profitierte von der unmittelbaren Nähe des Welthafens Hamburg. Es sei noch erwähnt, dass
Ziegeleien bis ins 20. Jahrhundert hinein einen bedeutenden Wirtschaftszweig darstellten.
Nicht die Wandse hat der Ortschaft den Namen gegeben. Vielmehr übertrug man den Namen
auf den Fluss, der in alter Zeit Bek oder Mühlenbek genannt wurde. Nachgewiesen werden
konnte, dass der Name Wandse 1821 Verwendung fand. Über die Bedeutung und Herkunft
des Namens Wandsbek gibt es keine eindeutige Meinung. Es könnte die Übertragung des
Eigennamens des früheren Bewohners Wanto auf den Ort sein oder auch mit Grenzort
(Wande, Grenze) erklärt werden. Der Wandse-Flusslauf, der jetzt erheblich weniger Wasser
führt und nicht mehr zur Kraftgewinnung genutzt werden kann, begleitet nun Erholung
suchende viele Kilometer weit durch einen Grünzug, zu dem auch der Eichtalpark gehört.
Wandsbek hat einen großen Anteil an der Prägung der heutigen Gestalt Hamburgs,
besonders wenn die Metropole als eine “grüne” Stadt gelobt wird. Nur wenige Straßen sind
nicht durch Bäume gesäumt, alte Ziegeleigruben sind zu Biotopen umgewandelt worden,
zunehmend werden Flussläufe renaturiert. In ganz Hamburg wurde zum Schutze der Bäume
ein strenges Gesetz erlassen.
Das Wappen
Das Wandsbeker Wappen wurde 1877 entwickelt, nachdem die
Kommune 1870 die Einwohnerzahl von 10.000 überschritten hatte und
zur Stadt erhoben worden war. Zu Ehren des Dichters Matthias Claudius,
des "Wandsbecker Boten"trägt es dessen Embleme Hut, Stock und
Botentasche (weiß auf blauem Grund mit goldener Halskrone) und als
Verbundenheit zum Kreis Stormarn in einem kleinen Schild dessen
Wappentier, den Schwan (weiß auf rotem Grund mit goldener Halskrone).
Aufbau des Archivs
Leider stehen aus alter Zeit für
Forschungen keine umfassenden
Archive zur Verfügung. Das städtische
Wandsbeker Heimatmuseum fiel dem
Bombenterror des 2. Weltkrieges zum
Opfer. Mühselig und zeitaufwändig war
der Neuaufbau einer historischen
Sammlung, die Wandsbeks Geschichte
in Berichten, Abbildungen und anderen
Dokumenten wiedergibt.
Da die kommunale Verwaltung sich dieser Arbeit enthielt, übernahm der Wandsbeker
Bürgerverein von 1848 e.V. diese Arbeit und kann heute stolz auf sein 1979 gegründetes
Archiv und Heimatmuseum sein, das seit Anbeginn von ehrenamtlichen Kräften geführt wird.
Darüber hinaus haben einige Mitbürger aus privater Verantwortung und geschichtlichem
Interesse bedeutendes Material zusammengetragen, das naturgemäß der Öffentlichkeit
kaum zur Verfügung steht.
Helmuth Fricke

Startseite
Aktuelles
Interessengruppen
Vereinsaktivitäten
Vereinsgeschichte
Wandsbek informativ
Geschichte Wandsbeks
Heimatmuseum
Heimatring Wandsbek
Unsere Förderer
Satzung des Vereins
Beitrittserklärung
Kontakt & Impressum